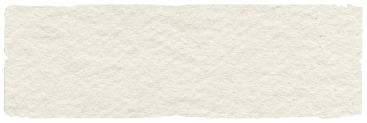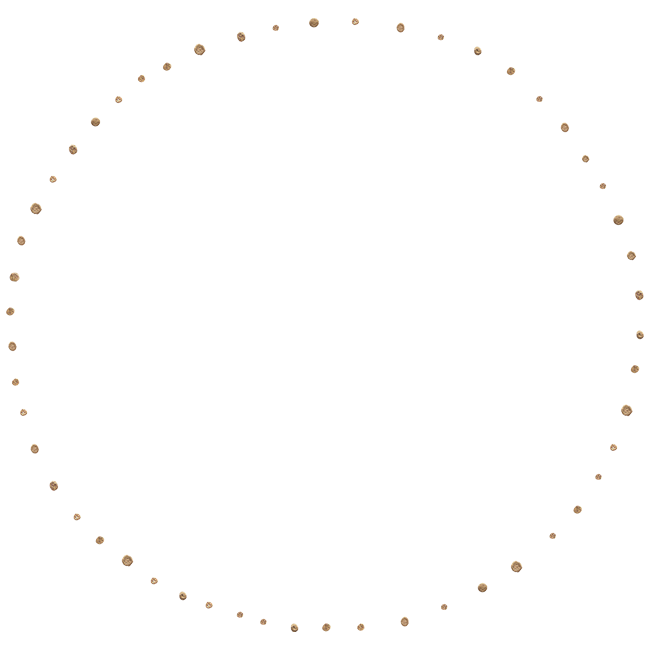„Wann holen wir endlich die Kiste mit den Weihnachtssachen?“ Wie oft habe ich als Kind diese Frage gestellt und dabei sehnsüchtig hinauf zum Dachboden geschaut! Wenn die Tage kürzer, nasser und kälter wurden, konnte ich die Adventszeit gar nicht mehr erwarten. Doch meine Eltern waren an dieser Stelle sehr klar: „Wir schmücken unser Haus nicht vor dem Ewigkeitssonntag!“
Bis heute halte ich mich an diese alte Regel meiner Eltern und Großeltern. Doch ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass diese Tradition mehr ist als eine Regel um ihrer selbst willen. Sie zeigt die tiefe Verwurzelung meiner Vorfahren im Kirchenjahr. Ihre bedingungslose Annahme des Lebens mit all seinen Höhen und Tiefen. Und sie zeigt, dass gerade das bewusste Begehen und Durchleben von dunklen und schweren Gedenktagen Kraft und Halt geben kann.
Monat ohne Höhepunkte
Mein Vater und meine Großeltern haben Weltkriege erlebt. Sie haben Menschen verloren. Sie wissen nicht nur aus abstrakten Erzählungen, warum wir einen Ewigkeitssonntag oder einen Volkstrauertag brauchen. Von den sieben Geschwistern meiner Großmutter sind nicht alle alt geworden und ihre eigene Mutter starb bei der Geburt der jüngsten Schwester. Meinem Opa blieben von seinem Vater nach dem Ersten Weltkrieg nur ein gemaltes Portrait und ein Name. Mein Vater verlor seine erste Frau in jungen Jahren.
Alt werden, seine Geschwister aufwachsen sehen, alle eigenen Kinder ins Erwachsenenalter bringen, die Eltern lange an der Seite haben und ein Leben in Frieden und Wohlstand – all das erscheint uns heute selbstverständlich. Doch nur ein bis zwei Generationen vor uns lagen die Dinge ganz anders. Die Alten hielten sich an den Gedenktagen des Novembers fest, weil sie ihren Sinn kannten. Sie waren Teil ihrer Welt, Teil ihres Lebenslaufs.
Und wir heute? Brauchen wir den November eigentlich noch oder wollen wir seine dreißig Tage möglichst schnell hinter uns bringen? Wenn wir kleine Kinder haben, basteln wir vielleicht noch eine Laterne und bekommen feuchte Augen, wenn sie das erste Mal damit losziehen und „Sankt Martin“ singen. Doch danach kann der November eigentlich gehen, oder? Es fehlen die Höhepunkte, die andere Monate zu bieten haben. Kein Schwimmbadwetter und keine langen Grillabende, so wie in den Sommermonaten. Keine frisch abgeernteten Felder, und die letzten bunten Blätter sind auch irgendwann verweht. Keine Neujahrseuphorie, nicht die hoffnungsvolle Luft einer wiedererwachenden Natur. Stattdessen ist es düster, eine matschige Mischung aus Schnee und Regen fällt vom Himmel und alle sind erkältet.
Sehnsucht nach Sicherheit
Kein Wunder, dass wir sehnsüchtig in Richtung Advent schielen. Im Dezember ist das Wetter draußen nicht besser als im November und erkältet sind wir immer noch – doch drinnen ist es viel gemütlicher. Kerzen, die nach und nach entzündet werden, bringen neues Licht und neue Hoffnung. Plätzchenduft und alte Lieder hüllen uns in eine gemütliche Decke und spenden Geborgenheit. Die Vorfreude auf das große Fest verdeckt dunkle Gedanken. Wäre es nicht viel schöner, wenn diese Zeit sechs bis acht Wochen lang wäre? Wieso sollten wir stattdessen diesen alten und sperrigen Tagen Raum in unserem Leben geben?
Ich glaube, dass wir es tun sollten, weil wir sie brauchen. Heute genauso wie unsere Eltern und Großeltern früher. Denn geben wir uns nicht einer trügerischen Sicherheit hin, wenn wir so tun, als hätte das alles nichts mehr mit uns zu tun? Ja, wir haben erstaunliche medizinische Fortschritte gemacht. Wenn wir heute Kinder zur Welt bringen, tun wir das, damit sie leben. Unsere Eltern haben die höchste Lebenserwartung, die es je gegeben hat, und unsere Geschwister gehen irgendwo auf der Welt ihre Wege. Zumindest wenn die Dinge gut laufen. Doch eigentlich wissen wir alle, dass sie nicht immer gut laufen.
Dunkel und zerbrochen
Wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umsehe, finde ich so einige, die ihre Eltern weit vor ihrem vierzigsten Geburtstag verloren haben. Ich habe Freunde, deren Geschwister durch Krankheiten oder Unfälle aus dem Leben gerissen wurden. Eine junge Bekannte ist bereits Witwe. Und leider ist nicht jedes Baby in meinem Umfeld zum Leben geboren worden. Auch meine eigene Familie ist nicht frei von Schmerz und Leid.
Und was ist mit unserer Welt? Brauchen wir nicht gerade heute einen Tag, der uns an die Grausamkeit von Kriegen erinnert, weil wir Europäer uns sonst einer allzu brüchigen Sicherheit hingeben? Sterben nicht täglich Menschen auf dieser Welt in sinnlosen Konflikten und verdienen nicht auch sie unsere Aufmerksamkeit?
Der November führt uns die Dunkelheit und die Zerbrochenheit unserer Welt so deutlich vor Augen wie kein anderer Monat im Jahr. Davor dürfen wir uns nicht dauerhaft verschließen. Wir leben in einer Welt, die es einem leicht macht, die Kargheit eines Monats wegzuschieben. Wir können uns ab September die besten Lebkuchen kaufen und auch darüber hinaus ist in einer multimedialen Welt gut für Ablenkung gesorgt. Allerdings nur so lange, bis sich die Endlichkeit des Lebens in unsere Mitte schiebt. Wenn jemand, den wir gern haben, krank wird oder stirbt, beginnen wir nach Ankerpunkten und Hoffnung zu suchen.
Bewusst hoffen
Ich glaube, dass der November so ein Ankerpunkt ist. Mit all seiner Tristesse und all seiner Dunkelheit. Mit seinen sperrigen Tagen. Mit Allerheiligen und Allerseelen, mit dem weltlichen Volkstrauertag und dem Ewigkeitssonntag bietet er uns zahlreiche Möglichkeiten, innezuhalten. Der November lädt uns ein, bewusst ein bisschen langsamer zu werden. Er erlaubt uns, auf die Punkte zu schauen, die schmerzhaft sind und die Angst machen.
Doch der November wird dadurch nicht zu einem Monat, der nur aus Dunkelheit und Traurigkeit besteht. Denn wir müssen nicht allein durch die Schattenseiten des Lebens gehen. Jesus ist in all der Zerbrochenheit unserer Welt schon da. Er hat all das überwunden, was uns Angst macht. Auch im November gilt, dass die Geschichte, die wir eine Woche nach dem Ewigkeitssonntag erwarten dürfen, Bestand hat. Bewusst im November zu sein heißt daher auch, bewusst in der Hoffnung zu bleiben, die uns geschenkt wurde.
Daniela Albert ist Erziehungswissenschaftlerin, Familienberaterin und Bloggerin. Dieser Artikel erschien in LYDIA 4/2019.