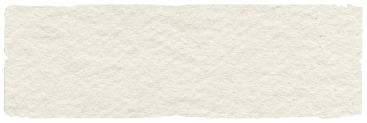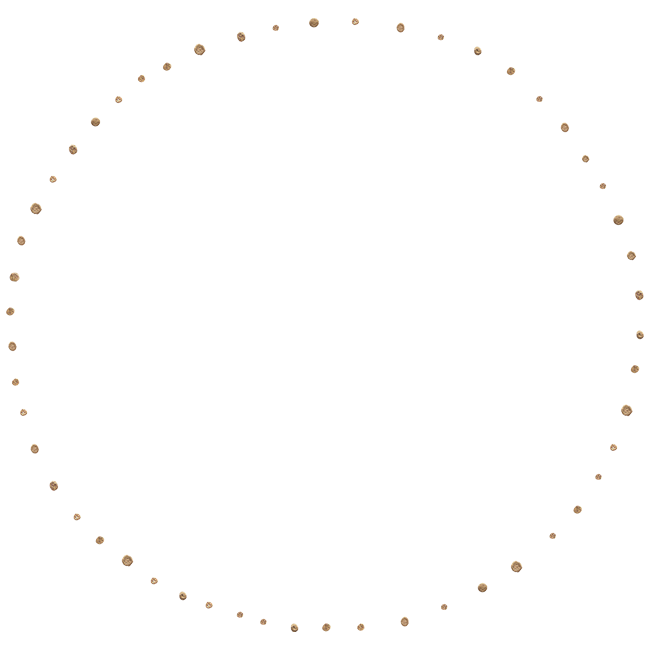Irgendwann Ende Oktober kam zum ersten Mal die Frage. „Was macht ihr eigentlich an Weihnachten?“ Sie ließ mich ratlos und sprachlos zurück. Im Grunde hätte sie mich nicht irritieren müssen, denn sie wurde uns jedes Jahr gestellt, obwohl wir während der Feiertage immer dasselbe taten. Doch im Oktober vor drei Jahren war nichts mehr dasselbe. Alles war anders. Hauptsächlich das „Wir“.
Ein Jahr zuvor hatten mein Mann Markus, unser Kind und ich noch ein „Wir“ gebildet. Dieses „Wir“ hatte keine in Stein gemeißelten Traditionen gehabt, aber bestimmte Vorlieben an Jesu Geburtstag: Ein Großelternteil kam für ein paar Tage zu Besuch. An Heiligabend stellten wir den Weihnachtsbaum auf – Hauptsache, er war schief, ein „Krüppelbaum“. Markus bereitete in der Küche das Essen vor – ein Gericht aus der Familie seines verstorbenen Vaters: Weißwürste mit Sauerkraut und Pfefferkuchensoße. Etwas, das er auch im Rollstuhl nahezu ohne Barrieren konnte. Deshalb durfte da auch niemand hineinpfuschen. Ein Blick von Markus genügte und wir verließen die heiligen Hallen vom Chef des „Essens auf Rädern“.
Es war ein augenzwinkerndes Wiederkehren jedes Jahr. Eins, über das man kaum sprach, weil es einfach dazugehörte, genauso wie der klebrige Schokoladenkuchen für Jesus, das Lesen der Weihnachtsgeschichte und die Bescherung unterm Tannenbaum. Bis Markus im Sommer darauf entschied, aus dem „Wir“ auszusteigen, aus dem ganzen Leben auszusteigen. Damit war schon im Sommer Weihnachten, wie wir es bis dahin kannten, vorbei. Für immer.
Leben nach der Abrissbirne
Im Juli 2016 beging Markus Suizid, genau einundzwanzig Jahre und einen Tag nach seinem Motorradunfall, nach über zwei Jahrzehnten Leben mit Querschnittslähmung. Zurück blieb ich mit meiner dreijährigen Tochter und einem Haufen Schulden, die er ohne mein Wissen im Laufe der Jahre angehäuft hatte. Ich verlor meine Stelle; bis dahin hatten wir gemeinsam auf Spendenbasis eine Beratungsstelle in unserem Haus betrieben – allein konnte ich sie nicht aufrechterhalten.
Was sich in drei Sätzen schildern lässt, fühlte sich in Wahrheit noch schneller an. Mit einem einzigen Ein- und Ausatmen, Markus´ letztem Atemzug, wurde unser komplettes Leben, wie es bis dahin gewesen war, zerstört. Als ob eine Abrissbirne ohne Vorwarnung ein bis dahin festes Mauerwerk in einzelne Steine, Mörtel und Staub zerschlägt, zerfetzt, zerrreist.
Es dauerte lange, Monate, Jahre, bis diese Partikel nach und nach verschwanden und ich meine Augen wieder öffnen konnte für das, was andere Leben nennen. Noch heute finde ich ab und zu Reste in meinen Haaren, Wimpern, Augenbrauen. Noch heute fällt mir manchmal das Atmen schwer, weil da noch Reste vom Staub rasseln, oder ich spucke kleine Stückchen aus von dem, was unser Leben einmal war.
Gleichzeitig drehte sich das Leben außen drei- bis viermal so schnell. Ich wurde dazu gezwungen, eine existenzielle Entscheidung nach der nächsten zu treffen, und entwarf in einer Woche so viele Lösungsmöglichkeiten wie andere Menschen in zehn Jahren. Ich brauchte und verbrauchte alle Kraftreserven. Ich fühlte mich wie aus der Zeit gefallen. Und das blieb erst mal so. Nach so vielen Umbrüchen gleichzeitig kam mir jede Woche vor wie ein ganzer Monat.
Ein wenig Struktur
Als meine Eltern und Markus´ Mutter fragten, was wir an Weihnachten vorhätten, war dieses Fest für mich deshalb so weit entfernt wie eine Reise nach Neuseeland. Auch für sie war der Verlust fundamental. Markus´ Mutter hatte ihren einzigen Sohn verloren. Für meine Eltern war Markus wie ein zweiter Sohn gewesen. Mein Vater war stinksauer auf ihn und wollte nicht mehr über ihn reden. Meine Mutter vermisste ihn sehr und fing wieder an zu rauchen. Sie sehnten sich – wie alle, wenn ein geliebter Mensch stirbt und eine Lücke hinterlässt – nach einer Art Normalität. Warum also nicht wie jedes Jahr fragen, was wir an Weihnachten vorhätten? Das brachte wenigstens etwas Struktur, etwas, das man planen und worauf man sich freuen konnte.
Im Gegensatz zu mir hatten sie aber noch ihr gewohntes Leben, ihre Wohnung, ihren Job, dieselben Menschen in ihrem Alltag. Ich hingegen wusste im Oktober weder, ob ich jemals wieder meinen Beruf würde ausüben, noch ob ich an Weihnachten überhaupt in unserem Haus würde leben können – geschweige denn, ob ich überhaupt das Geld hätte, meiner Tochter ein Geschenk zu kaufen. Auch wenn in den Läden längst der Vorweihnachtsstress propagiert wurde, fühlte sich dieses „Fest der Liebe“ für mich Jahrzehnte entfernt an.
Ein neues „Wir“
Und dann passierte etwas, womit ich niemals gerechnet hatte. Einige Wochen nach Markus´ Suizid kam ein Freund zum Helfen vorbei. Mit einem Kuchen und einem Blumenstrauß. Etwas, das man nicht erwartet, wenn man sich hauptsächlich mit Schulden beschäftigt. Es war etwas absurd. Ich musste lachen. Eines der wenigen Male seit Markus´ Tod. Ich kannte diesen Mann bis dahin nur aus dem Internet und nannte ihn den Wikinger, weil er einfach so aussah. Meine Tochter, die sich bis dahin schwer mit fremden Menschen getan hatte, nahm ihn an die Hand und ging mit ihm Blümchen pflücken. Später setzte er sich aufs Sofa und sofort kamen Hund und Katze zu ihm. Es war, als hätte er schon immer bei uns gewohnt. Als hätte sich allein durch sein Auftauchen ein neues „Wir“ ergeben. Bis dahin hatte ich gedacht, dass sie eine Erfindung aus Hollywood ist oder eine hormonelle Sache, die Liebe auf den ersten Blick. Doch als ich dem Wikinger das erste Mal in die Augen schaute, setzte es in mir drin irgendwie aus. Etwas, das ich so noch nicht kannte. Und er auch nicht.
Die große Lücke
So kam es, dass „wir“ zusammen Weihnachten feierten. Er ergänzte das Fest mit Baumschmuck und niederländischen Süßigkeiten. Meine Eltern waren zu Besuch, ein paar Tage später kam Markus´ Mutter und kochte das Weihnachtsgericht, das Markus sonst immer zubereitet hatte.
Doch trotz des gelungenen Versuchs, ein neues Leben zu gestalten, gemischt aus alt und neu, blieb sie da, die Lücke. In der Küche fiel sie auf, weil sich alle außer mir darin aufhielten. Instinktiv mied ich die Küche, weil sie für mich immer noch der Raum von „Essen auf Rädern“ war. Am Ende des Tages wollte ich nur noch weglaufen aus dieser Kulisse, diesem „so tun, als ob“.
Irgendwann stellte ich fest, dass ich mich allein fühlte. Weil der Schokoladenkuchen fehlte. Der Geburtstagskuchen für Jesus. Die Weihnachtsgeschichte. Die Feierlaune. Es fehlte nicht nur Markus, sondern gefühlt auch Jesus. Der Heiligabend war einer der wichtigsten Feiertage für mich gewesen. Und jetzt?
Weihnachten war in diesem Jahr nicht einfach Weihnachten. Es war auch nicht nur Jesu Geburtstag. Es war fast auf den Tag genau fünf Monate her, dass Markus sich das Leben genommen hatte. Und auch wenn ich eine neue Familie hatte, wenn ich geliebt wurde und liebte, liebte ich Markus nicht weniger und vermisste ihn nicht weniger. Der fehlende Schokoladenkuchen machte die Lücke deutlich, die er hinterlassen hatte.
Vielleicht hatte ich den Schokoladenkuchen unterbewusst absichtlich nicht gebacken. Weil ich wütend war wegen der „Freiwilligkeit“ von Markus´ Tod. Das stimmt natürlich nicht. Niemand nimmt sich freiwillig das Leben. Dem voraus geht ein langer verborgener und furchtbarer seelischer Kampf. Doch für die, die zurückbleiben, fühlt sich das manchmal so an. Weil er sich – subjektiv betrachtet – gegen das Leben mit den geliebten Menschen entschieden hatte.
Der fehlende Kuchen war wie das leere Kreuz. Dieses erste Weihnachten war kein Feierfest für mich. Es war ein Trauertag. Vielleicht der erste wirkliche Trauertag nach Markus´ Tod. Weil vorher kein Raum dafür gewesen war. Aber an diesem Weihnachten, meinem ersten Weihnachten als Witwe, da konnte ich trauern. Und den nicht vorhandenen Schokoladenkuchen am Kreuz bei Jesus abgeben. Mein Geschenk an Jesus war meine Trauer. An diesem Tag durfte er sie für mich tragen. Wer sonst, wenn nicht Jesus, konnte nachvollziehen, wie sich dieser Schmerz anfühlt. Verlassen zu werden. Verraten zu werden. Und trotzdem zu lieben.
Ein Fest der Trauer
Seit diesem ersten Weihnachten als Witwe begehe ich diese Zeit anders. Ich versuche es zumindest. Mit dem Fest der Liebe habe ich noch so meine Schwierigkeiten. Weil Liebe eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Weil Liebe auch Schmerz bedeutet, wenn man nicht in gleicher Weise zurückgeliebt wird oder wenn Menschen, die man liebt, nicht mehr da sind. Deshalb bleibt das Fest der Liebe für mich seitdem immer auch ein wenig ein Fest der Trauer.
Weihnachten selbst feiern wir nun wie immer, auch wieder mit Schokoladenkuchen und Weihnachtsgeschichte. Ab und zu kommt etwas Neues hinzu. In diesem Jahr, drei Jahre nach Markus´ Tod, möchte ich für Jesus eine Geburtstagskerze anzünden. Als Symbol dafür, das Leben zu leben. Dass es sich entwickeln darf. In seinem Tempo. Dass auch aus Asche neues Leben entstehen kann.
Nicole Schenderlein ist Projektleiterin von „Blattwenden“ – einem gemeinnützigen Angebot auf Spendenbasis für (Suizid-) Hinterbliebene und Menschen in Lebensumbrüchen.